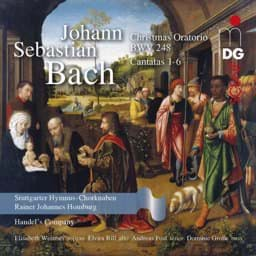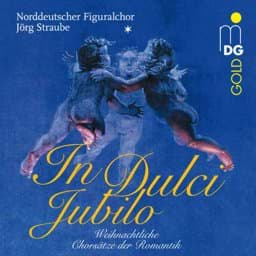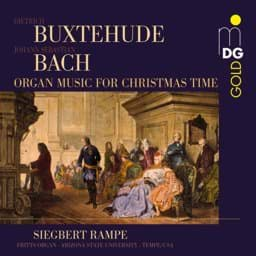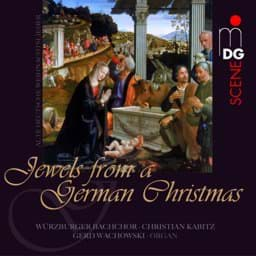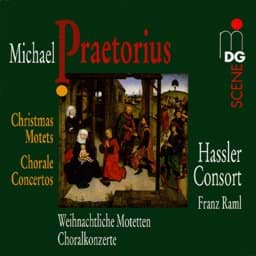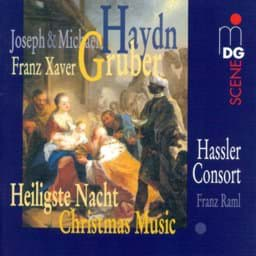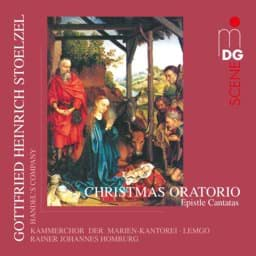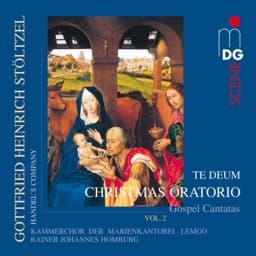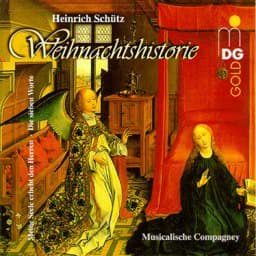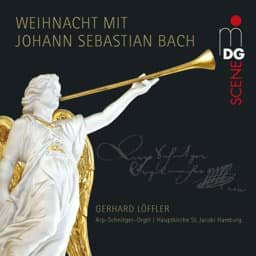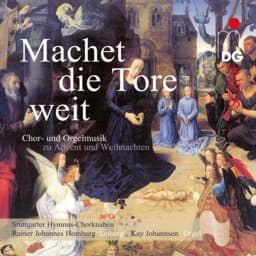Beschreibung
Ein moderner Komponist, der sich entschließt, ein Weihnachtsoratorium zu schreiben, muss mit Misstrauen rechnen: Konservative Hörer kennen nur das „eine“ Weihnachtsoratorium, nämlich das von Bach. Selbst vergleichbare Werke von Schütz bis hinunter zu Saint-Saens finden kaum Akzeptanz. Andererseits muss er mit der Skepsis derjenigen rechnen, die es für einen Komponisten unserer Zeit für verfehlt halten, sich einem solchen musikalischen Thema zu widmen, anstatt sich der Avantgarde zu verschreiben (sowohl in thematischer als auch in kompositionstechnischer Hinsicht). Vielleicht war es diese unversöhnliche Position, die den Schriftsteller Dietrich Mendt und den Komponisten Matthias Drude inspirierte: die Herausforderung, ein zeitgenössisches Weihnachtsoratorium im Spannungsfeld zwischen traditionellen und modernen Bezügen zu schaffen, das eine breite, aber kontroverse Rezeption anstrebt.
Der Titel „Weihnachtsoratorium“ trifft auf die Komposition jedenfalls zu - zumindest auf den ersten Blick. Obwohl das Evangelium in vielfältiger, kontrastreicher Weise reflektiert wird, wird es im Wesentlichen bestätigt. Zugleich stellt Mendt Bezüge zur heutigen Situation des Menschen her, wobei die Aussage „Gott wird ein Kind“ im Zentrum dieser Verbindung steht. Musikalisch verweisen der offensichtliche Dreiklang des Werkes, aber auch musikalische Formen wie „Eingangschor“, „Rezitativ“, „Arie“, ja sogar „Pastoralsinfonie“ zu Beginn des Mittelteils auf die Tradition des barocken Oratoriums. Laut Vorwort der Partitur war es das Ziel des Komponisten, „Zugeständnisse an den Hörer“ zu machen - kein „Anti-Weihnachtsoratorium“ zu schaffen.
Offensichtlich hatte diese Entscheidung einen großen Einfluss auf die Grundkonzeption der Komposition.
Trotz des Reichtums an klanglichem Ausdruck schöpft Drudels aus einem erstaunlich geringen Vorrat an musikalischem Grundmaterial. Wenige kurze, flexible Gesten tauchen in immer neuer Umgebung auf und geben der Komposition so ihren inneren Zusammenhalt.
Ähnliche Produkte
J. S. Bach - Weihnachtsoratorium, BWV 248
Weihnachtsoratorium BWV 248
Elisabeth Wimmer, Sopran
Elvira Bill, Alt
Andreas Post, Tenor
Dominic Große, Bass
Tro...
In dulci jubilo - Weihnachtliche Chormusik
Weihnachtliche Chormusik der Romantik
Norddeutscher Figuralchor
Jörg Straube, Dirigent
Hybrid-SACD
D. Buxtehude & J. S. Bach - Weihnachtliche Orgelwerke
J.S. Bach (1685-1750)
„Orgelmusik zur Weihnachtszeit“
Siegbert Rampe
Orgel von Paul Fritts & Co., Tacoma/Washin...
Alte Deutsche Weihnachtslieder/ Weihnachtliche Orgelmusik
Alte deutsche Weihnachtslieder
Weihnachtliche Orgelmusik
Bachchor Würzburg
Christian Kabitz, Dirigent
Gerd Wa...
Michael Praetorius - Weihnachtliche Motetten
Weihnachtliche Motetten und Choralkonzerte
Hassler Consort
Franz Raml, Dirigent
Joseph & Michael Haydn & F. Gruber - Heiligste Nacht
Franz Xaver Gruber (1787-1863)
„Heiligste Nacht“
Weihnachtliche Motetten
Hassler Consort
Franz...
Gottfried Heinrich Stoelzel - Weihnachtsoratorium Vol. 1
Weihnachtsoratorium Vol. 1
Epistel-Kantaten
Solisten
Handel's Company
Kammerchor der Marien-Kant...
Gottfried Heinrich Stoelzel - Weihnachtsoratorium Vol. 2
Weihnachtsoratorium Vol. 2
Evangeliums-Kantaten
Te Deum
Solisten
Handel's Company
Kammerchor...
Heinrich Schütz - Weihnachtshistorie
Weihnachtshistorie
Musicalische Compagney
Weihnacht mit Johann Sebastian Bach
Weihnacht mit Johann Sebastian Bach
Orgelbüchlein
Gerhard Löffler
Arp-Schnittger-Orgel, Hauptkirche St. Ja...
Machet die Tore weit - Weihnachtliche Chormusik
Weihnachtliche Chormusik von
Hammerschmidt, Praetorius, Schmidt, Schütz, Clanché, Willcocks, Brahms, Eccard, Reda, Riede...